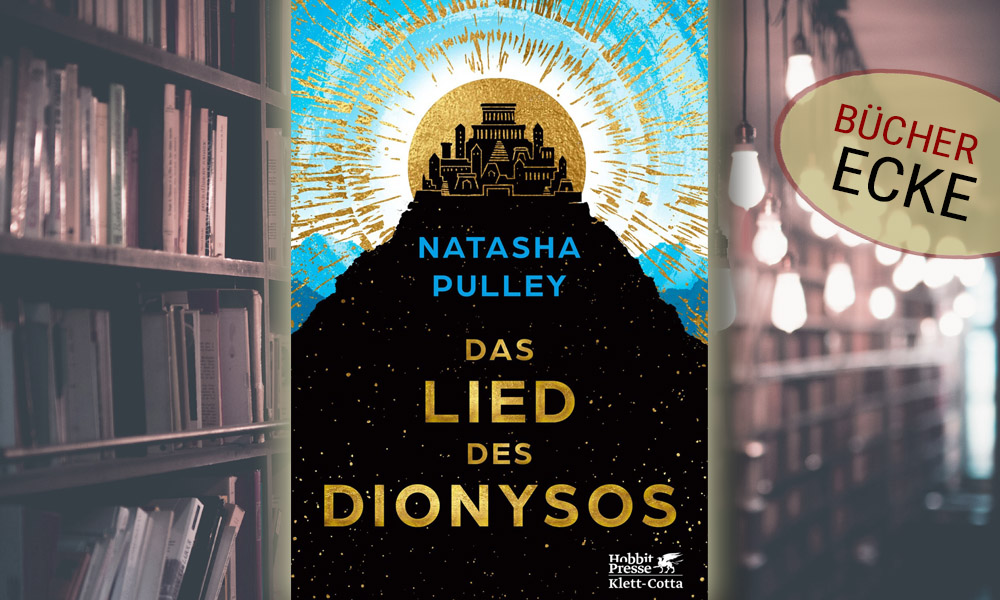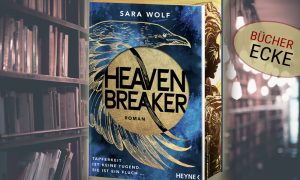Der Krieger Phaidros, in Jahren gemessen eigentlich immer noch ein junger Mann, zählt in den legendären Legionen des griechischen Königreichs Thebens fast schon zum alten Eisen. Von klein auf zum Soldaten gedrillt und Veteran des Trojanischen Krieges hat er schon zahllose Schlachten erlebt und überlebt. Aber seit dem Tod seines Kommandanten Helios, an dem er die Schuld trägt, ist er in Ungnade gefallen und nun für die Jungen Krieger verantwortlich, die – so wie er selbst einst – von Kindesbeinen an zum Kämpfen erzogen werden und nichts Anderes kennen. Pflichterfüllung ist Ehre, so lautet der Wahlspruch der Legionen, die denen Spartas in nichts nachstehen, und deren siegreiche Raubzüge und Plünderungen den Reichtum Thebens begründen. Die Krieger sind geachtet und erfüllen gewissenhaft ihre Rolle, sind aber auch strengen Regeln und Vorschriften unterworfen.
Wie wenig ein Leben dabei zählt, wenn es um das Wohl des Reiches und der könglichen Familie geht, erfährt Phaidros schon in sehr jungen Jahren, als er gemeinsam mit Helios, dessen Mündel er ist, erstmals mit seiner Legion nach Theben zurückkehren darf. Dort besuchen sie Helios’ Zwillingsschwester Agaue, die die Königin Thebens ist, sowie ihre gemeinsame Schwester Semele, deren Baby ein Kind des Göttervaters Zeus sein soll. Phaidros versteht nicht, was in der Welt der Erwachsenen um ihn herum vorgeht, aber als es zu einem Brand im Königspalast kommt, rettet er dem Baby das Leben – nichtsahnend welche Konsequenzen das für Theben und sein eigenes Leben haben wird.
Mehrere Jahre vergehen, bis Phaidros den kleinen Jungen auf der Rückfahrt von Troja nach Theben wiedersieht: Der Junge steht, in kostbare Gewänder gekleidet, allein am Strand einer Insel, als hätte er auf sie gewartet. Die Krieger nehmen ihn an Bord und Phaidros weiß, dass dem Jungen damit das schreckliche Schicksal bevorsteht, als Sklave nach Ägypten verkauft zu werden. Er möchte dem Jungen helfen, vermag es aber nicht, gegen die Konventionen und die Gemeinschaft der Legion zu verstoßen. Während Phaidros noch mit seiner eigenen Rolle in all dem hadert, beginnt sich das Schiff plötzlich in seine ursprüngliche Beschaffenheit zurückzuverwandeln: aus Masten werde Bäume, aus Seilen Efeuranken. Die Griechen trauen ihren Augen nicht, sind dem sie umgebenden Wahnsinn aber hilflos ausgeliefert. Einzig und allein Phaidros schafft es, zu entkommen und schließlich lebend nach Theben zurückzukehren.
Der Wahnsinn greift um sich
Jahre später, als Phaidros eine Kohorte der jungen Krieger befehligt, wütet in Theben eine schwere Dürre, die zu einer großen Hungersnot geführt hat. Die Zustände in der Stadt werden immer bedrohlicher und geraten schließlich vollends außer Kontrolle, als während eines Opferrituals ein Unglück geschieht und Agaues Sohn, Prinz Pentheus, verschwindet. Welche Rolle spielte der Hexer Dionysos dabei, der Phaidros bei dem Ritual das Leben rettet, und der ihn mit seinen tiefblauen Augen so sehr an den Jungen von damals erinnert? Was hat es mit den verbotenen Gesängen und Tänzen auf sich, die zuerst unter den Kriegern und schließlich in ganz Theben Besitz von den Menschen ergreifen, als wären sie besessen? Phaidros ist sich sicher, dass Dionysos, der mit seinen geheimnisvollen Masken ein seltsames Spiel zu treiben und auf einmal überall und nirgends zu sein scheint, etwas damit zu tun hat. Ehe Phaidros es sich versieht, steckt er in mitten von Palastintrigen, dem Zwist der Götter und dem Konflikt zwischen ewigem Gehorsam und dem Wunsch, frei zu sein.
Ausblick auf die Gegenwart
Auch wenn Pulleys Roman in der Antike spielt, hat er doch viel mehr mit unserer Gegenwart zu tun, als es das historische Gewand der Geschichte zunächst vermuten lässt. Er ist vielmehr die Neuinterpretation der Gegenwart durch die Vergangenheit, quasi das Gegenstück zur Science Fiction, die die Gegenwart in der Zukunft analysiert.
Die Pflicht und der Gehorsam stehen über allem, Gefühle sind nicht gewollt. Ein Menschenleben zählt nichts, schon gar nicht, wenn es sich um Sklaven oder einfache Bürger handelt. Für die Ehre wird die eigene Familie geopfert, Befehlen wird bedinungslos gehorcht. Während die Adeligen im Luxus leben, droht die Bevölkerung Thebens zu verhungern und weiß sich nicht mehr anders zu helfen, als sich selbst als Skalven zu verkaufen. Die Krieger sind eine geschlossene Gemeinschaft, einander treu ergeben bis in den Tod, aber der Tod eines anderen Menschen bedeutet ihn nichts. Sie sind willenlose Werkzeuge des Königshauses und scheinen manchmal jeglicher Menschlichkeit beraubt, um im nächsten Augenblick verspielt und witzig zu sein. Alle tragen eine Maske – ob im übertragenen Sinne oder in der Wirklichkeit des Wahnsinns, den Dionysos heraufbeschwört.
Mehr als ein historischer Fantasy-Roman
Das Buch entwickelt seinen ganz einen Sog, dem man immer schwerer widerstehen kann – so als ob auch die Leser Dionysos und seinem Zauber verfallen. Geschickt verknüpft Pulley Mythen und Magie miteinander und webt daraus ihre ganz ureigene phantastische Geschichte: Es gibt magische Elemente wie den alles überwuchernden Efeu oder die Masken, die sich auf ihre Träger auswirken, und natürlich die Wunderwerke – mechanische Statuen, die ein bisschen an die magischen Kunstwerke des Uhrmachers in der Filigree Street erinnern, wenn auch viel größer, und gleichzeitig so real erscheinen, dass man es für möglich hält, dass es sie wirklich gegeben hat. Das Lied des Dionysos ist viel mehr ein historischer Fantasy-Roman, mehr als eine typische Nacherzählung der Legende aus der Antike, das Hauptaugenmerk der Geschichte liegt auf Phaidros und seiner Freundschaft zu Dionysos. Phaidros ist zu Beginn des Romans erst vier Jahre alt, und so sieht der Leser die antike Welt zunächst aus der Sicht eines Kindes. Phaidros versteht die Welt der Erwachsenen nicht, aber für die Leser erschließt er mit seinen Fragen und seiner Navität mehr von den Geschehnissen um ihn herum, als für sich selbst. Der ältere Phaidros kämpft mit Panikattacken und leidet – wie viele die Krieger – unter posttraumatischen Störungen, die damals noch niemand so genannt hat. Er ist sarkastisch, witzig und verletzlich zugleich, unter seiner Kriegerrüstung ist er der kleine Junge geblieben, der mit seinen Pflichten und der totalen Ergebenheit in Gehorsam und Pflicht einerseits und seinen Gefühlen und Wünschen andererseits kämpft. Er fürchtet sich davor, eine Ehe einzugehen, wie es von ihm erwartet wird, aus Angst, sich zu erschrecken und seine Frau aus Versehen im Affekt umzubringen. So verwundert es nicht wirklich, als einige der Krieger beginnen, ihren Verstand zu verlieren, und Phaidros erst durch einen Gott erkennt, was es bedeutet, ein Mensch zu sein, während um ihn herum die Welt in den Abgrund zu taumeln scheint – eine Lektion in Mitgefühl und Achtsamkeit, die noch lange nachhalt.
»Im Laufe der Zeit werden sie [die Menschen] zu weit gehen, sie werden ihr Wesen und ihre Grenzen vegessen. Und wo immer sie das tun, wirst Du sein. Du bist der Wächter und das Gedächtnis und der Wahnsinn. In den Zeiten, die kommen, werden die Menschen einen Gott brauchen, der sie daran erinnert, was sie sind. […] Öffne die Augen.«
Außergewöhnlich einfallsreich
Natasha Pulley ist eine außergewöhnliche Autorin mit ungeheuren Einfallsreichtum. Sie schreibt historisch basierte Romane, die sie dann phantastisch ausprägt. Ihre Geschichten sind vielschichtig, in diesem Fall sogar buchstäblich labyrinthisch, immer persönlich und spannend bis zuletzt. Nicht immer kann man ihren ausgelegten Hinweisen und Spuren sofort folgen – hier ist aufmerksames Lesen gefragt! -, doch je weiter man kommt, desto klarer werden die Zusammenhänge und der tiefere Sinn. Noch gesteigert wird das Ganze durch Pulleys ruhige Erzählweise, die trotz der dramatischen, ja zum Teil furchtbaren Ereignisse, eine umso tiefgreifendere Wirkung hat, gerade weil sie nicht dramatisch oder reißerisch wird.
Sie schafft es sogar, sehr subtil und mit einem großen Augenzwinkern, daran zu erinnern, wie unbedeutend und klein wir eigentlich für die Erde sind – nicht wichtig genug, dass die Natur überhaupt an die Menschen denkt – schließlich wird sie lange noch da sein, nachdem »die Menschen sich vom Angesicht der Erde gesprengt hätten.« Von den Menschen dagegen wird nach tausenden von Jahren nur noch ein bisschen Gekritzel von simplen banalen Altersgebräuchen übriggeblieben sein.